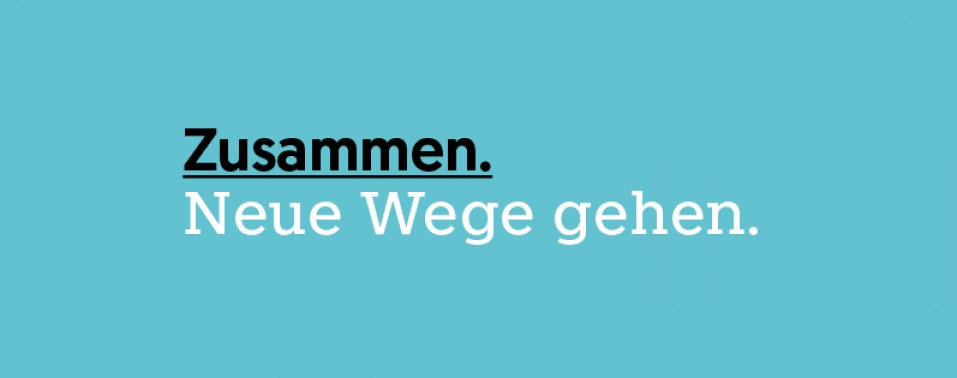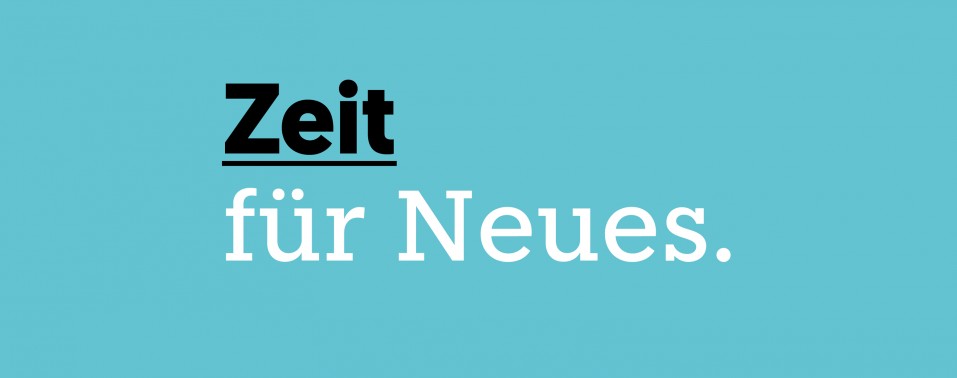Facts über Parndorf
Hardfacts
Lage: 47° 59′ 40″ N, 16° 51′ 30″ O
Bundesland Burgenland, Bezirk Neusiedl am See
Höhe: 182 m ü. A.
Einwohner: 4170 (1.Jänner 2011)
Postleitzahl: 7111
Fläche: 59,29 km²
Adresse Gemeindeamt: Hauptstraße 52a
Politische Verwaltung:
Bürgermeister: Ing. Wolfgang Kovacs (LIPA)
Gemeinderat : 10 SPÖ, 7 LIPA, 4 ÖVP, 1 FPÖ, 1 Freier Mandatar (ehm. SPÖ)
Nachbarortschaften
Neusiedl am See
Bruckneudorf
Neudorf
Jois
Geschichte
Orstnamenformen: 1264: Perun (Arp. Okm. VIII, 89, n. 60). 1423, 1430: Poss. Parendorff (Csánki III, 684; Schwartz 104). 1430, 1432: Perendorff (ebd.). 1435: Perenndorff (ebd.). 1440: Pentorff (ebd.). 1469: Perndorff (ebd.). 1550, 1570, 1571 1600, 1649, 1773; Pandorff (Schwartz 104). 1600: Beyrndorf (KHA, B 29/E, n. 258). 1808: Pandorf, Padendorf, Parendorf (ebd.). 1863: Parndorf (ebd.).
Ur- und Frühgeschichte
Aus dem Gemeindegebiet größere Menge jungsteinzeitlicher Streufunde, vor allem Steinbeile, ohne nähere Fundortbezeichnung im Museum Bruck a. d. L. (1945 in Verlust). Im Jahre 1938 wurde in der Sandgrube westlich der Straße nach Neusiedl und nördlich der Straßenabzweigung nach Jois ein Skelettgrab der frühbronzezeitlichen Wieselburger Kultur mit Gefäß und Bronzebeigaben aufgefunden. In älterer Literatur werden keltische Silbermünzen mit den Namen BIATEG und NONNOS, aus dem Gemeindegebiet Parndorf stammend, beschrieben. Die ausgedehnte römische Ansiedlung beim Heidehof wird im Fachschrifttum unter Bruck a. d. L. - Bruckneudorf, Parndorf oder Parndorfer Heide behandelt (FaÖ und bei Pascher G.), in der Topographie unter Röm. Gutshof zusammengefaßt. Römische Gebäude stellt A. Sötér im Jahre 1893 auf der rechten Seite des Weges von Parndorf nach Neusiedl fest, wo er eine starke Mauer auf mehrere Meter freilegte; neben dieser fand er u.a. römische Münzen. Diese Ansiedlung wird eventuell noch mit der römischen Anlage bei Heidehof in Verbindung zu bringen sein. Von einer weiteren Siedlung auf dem Hang bei den "Pfarräckern" berichtet A. Sötér 1897. Auf der Parndorfer Heide, am Ost-Ortsausgang nördlich nach Neudorf führenden Straße, wurden 1937 zwei römische Gräber, Ziegel- und Steinplatten, am Rande einer Wasserlacke freigespült; es wird hier eine größere Nekropole vermutet. Eine römische Sarkophagbestattung ohne Beigaben ist aus der Ried "Stanza Goriza" bekannt, in ihrer Nähe wurden Bruchstücke eines Hallstattgefäßes gefunden (Lit.: FaÖ I [1930--1934], 44, 216; II [1935-1938], 132, 227; III [1938-1939], 21, 47; Pascher G., RliÖ, Sp. 18 f.; Sötér A., MEK 249 f.).
Mittelalter und Neuzeit
Am 25. März 1264 schenkt König Béla IV. dem Wieselburger Bürger Leopold, der bereits im Besitze des Dorfes Parndorf war, die Hälfte des Waldhüterbesitzes Kaal, da Leopold ohne die erbetene Vermehrung den Ort nicht behaupten konnte. Die andere Hälfte wurde schon früher den Hospites von Neusiedl überlassen. Bevor Leopold in den Besitz von Parndorf gelangte, war es Bestandteil der Komitatsburg in Wieselburg (Arp. Okm. VIII, 89, n. 60; Homma, Wüstungen 62). O, 15. Jh. Hatten in Parndorf auch die Gara Besitzrechte, 1432, Jänner 24, bestätigt König Sigismund die Teilung der Güter zwischen dem Palatin Nikolaus de Gara und dessen Söhnen Nikolaus und Ladislaus, unter die auch Potzneusiedl sowie eine Portion in Parndorf mit dem Gut Neudorf fielen, die früher Eigentum des verstorbenen Paul de Athya waren (Jandrisevits, Urkunden, II, 97, n. 31).
Einige Zeit später gelangten die Grafen von St. Georgen und Bösing in den Besitz des Ortes. Im Jahre 1525, nach dem Aussterben der Bösing-Ungarisch-Altenburger Linie, gestattete König Ludwig II. von Ungarn Leonhard III. von Harrach die Erwerbung von Parndorf und Neudorf (vgl. allgemeiner Teil), außer einigen Anwesen, die im Besitze der Herrschaft Ungarisch-Altenburg verblieben (1546, Urbar der Herrsch. Ungarisch-Altenburg, Kopie im Bgld. Landesarchiv, Eisenstadt). Sowohl Parndorf als auch das zur Herrschaft Ungarisch-Altenburg gehörige Gut Neudorf fielen der Türkeninvasion von 1529 zum Opfer. Die Neubesiedlung des Ortes durch Kroaten aus dem Küstengebiet führte zu Hotterstreitigkeiten mit den Gattendorfern (1556 Decr. XVII. art. 45, C J H, I, 477) und Neusiedlern, wobei die Neusiedler den Parndorfern 30 Stück Ochsen wegtrieben (1568, HKA, B 29/E, n. 10 ff.). Ende des 16 Jh.s führten finanzielle Schwierigkeiten zur Verpfändung beider Orte, wobei die Stadt Bruck a. d. L. als Geldgeber in schwere Bedrängnis geriet, da das Komitat unter Hinweis auf die ungarischen Freiheiten den Pfandvertrag annullierte, jedochHarrach die von den Bruckern vorgeschossene Summe bereits anderweitig verwendet hatte. So entspann sich ein jahrelanger Streit, bis schließlich der Kaiser als König von Ungarn die Rechtsansprüche der Brucker ablöste und beide Dörfer zur Herrschaft Ungarisch-Altenburg schlug. Als Karl von Harrach 1619 Hauptmann und drei Jahre später für eine Summe von 302.000 Gulden Pfandinhaber von Ungarisch-Altenburg geworden war, hoffte er auf deren Rückstellung, da in dem genannten Betrag auch der Kaufpreis für die beiden Ortschaften enthalten war. Der Kaiser hinwieder beabsichtigte, Harrach die Herrschaft völlig zu überlassen, was dessen Sohn Leonhard Karl wegen Unrentabilität jedoch ablehnte.Am 18. Mai 1636 wurde dann ein endgültiger Vertrag abgeschlossen, nach dem Kaiser Ferdinand II. die Herrschaft Ungarisch-Altenburg mit Ausnahme der beiden Dörfer Parndorf und Neudorf zurücknahm (vgl. allgemeiner Teil).
Im Jahre 1597 ersuchte Mechmed Pascha, der Beglerbeg von Raab, die Hohe Pforte, dem bereits alt gewordenen Sandsakbeg von Koppány, Dervis, zehn Dörfer an der österreichischen Grenze, darunter auch Parndorf, zum Ruhegenußnzu schenken, damit er sie wieder aufbaue (vgl. allgemeiner Teil).
1619 wurde Parndorf von den Scharen Bethlen Gábors heimgesucht. Ein Jahr später war dessen Kriegsvolk abermals in diesem Gebiet. Westlich Parndorf kam es zu einem Scharmützel zwischen Kaiserlichen und Aufständischen. Die im Jahre 1679 wütende Pest ließ auch in Parndorf ihre traurigen Spuren zurück (Vukovich, Hausarbeit 31). 1683 erhielten die Parndorfer einen Schutzbrief (vgl. Neudorf). Die Kuruzzenkriege im beginnenden 18. Jh. Bekam der Ort gleichfalls zu spüren. Am 20. November 1709 wurde die alte Schanze von Pálffys Regimentern besetzt.
In den sechziger Jahren des 18. Jh.s setzte ein Teil der Parndorfer in Abwesenheit des Grafen den ihnen unliebsamen Richter Herschiz ab und bestellten von selbst einen anderen Richter namens Schutriz. Diese Eigenmächtigkeit brachte das Dorf in hellen Aufruhr, wobei sich besonders das weibliche Geschlecht bemerkbar machte. Militär musste angefordert werden, der Vizegespan und der Stuhlrichter versuchten vergebens, die aufgeregten Gemüter zu beruhigen, zumal einige Jahre vorher Schutriz wegen Amtsmissbrauches enthoben worden war. Das Militär wurde mit einem Steinhagel empfangen. Erst nachdem die sechs Rädelsführer abgeführt worden waren, konnte die Ruhe wiederhergestellt werden. Auch Neudorf wurde von dieser Unruhe erfasst, die ja letzten Endes in der allzu hohen Robot ihre Wurzel hatte. Ein neuer Fiskal sollte die Klagen der Bewohner überprüfen.
Die undurchsichtige Rechnungsführung in der Gemeinde und die hohen Kontributionen lösten 1789 abermals eine Rebellion aus, die zur Deportierung von fünf Bauernfamilien in das Banat führte. Zahlreiche Bittschriften an den Grafen, welche die verleumderischen Aussagen des Richters und Schulmeisters zu wiederlegen versuchten, blieben genau so wirkungslos wie die Interventionen des Parndorfer Postmeisters Paul Kugler, der zugunsten der Verurteilten aussagte (vgl. allgemeiner Teil).
Von Graf Harrach wurde am Südende des Ortes ein Schloss erbaut, das Karl VI. und Maria Theresia auf ihren Fahrten nach dem Jagdschloß Halbturn als Raststation diente. Hofjagden fanden auf Parndorfer Gemeindegebiet statt. Unweit des Schlosses befand sich der "Hatzhof", der zur Unterbringung der Jagdhunde diente. Das selbst hatten die Bauern dem Grundherrn auch den Zehent abzuliefern, und hier mussten sie zur Robotleistung antreten. In der Zeit Maria Theresias und Josefs II. macht sich nach den Pfarrmatriken auch eine Germanisierung der kroatischen Bevölkerung bemerkbar. Kroatische Familiennamen wurden übersetzt oder von ähnlichen klingenden Namensformen abgelöst (so wurde aus Puk - Böck, aus Podvorcic - Kammerhofer, aus Skutaic - Gutdeutsch). Nach einer mündlichen Überlieferung sollen damals die kroatischen Gebetbücher verbrannt worden sein (Vukovich 39). Der bislang auf der Straße Nickelsdorf über Parndorf nach Wien getätigte Schlachtviehauftrieb wurde im Jahre 1802 vom Grafen verboten, weil die Viehtreiber immer wieder auf den Wiesen weiden ließen und dadurch die Ernährung des eigenen Viehbestandes in Frage gestellt war (Bruck a. d. L., Gräfl. Harrachsch. Herrschaftsarchiv, Fasz. Parndorf).
Im Ort befand sich eine von der Herrschaft unterhaltene wichtige Poststation, die 1837 Graf Ernst an Ludwig Schmidt und Karl Proske auf sechs Jahre verpachtete. Im gleichen Jahre plante das Komitat mit Umgehung von Parndorf und Zurndorf eine Relaisstation zu errichten. Dadurch währe vom Komitat nur die Straße von Parndorf bis Zurndorf in Ordnung zu halten, während bisher die gerade Straße von Parndorf nach Wieselburg instand zu halten war. Diese Neuregelung wünschte vor allem die Herrschaft Ungarisch-Altenburg, da sie sich hievon wirtschaftliche Vorteile erhoffte (vgl. allgemeiner Teil).
1809 zogen die französische Kavalleriedivision Montbrun über die Vodenjakfelder von Bruck nach Neusiedl, die italienische Armee des Vizekönigs Eugen Beauharnais auf ihrem Marsch von Raab nach Wien durch den Ort. 1854 wurde der Ausbau der Eisenbahnlinie von Bruck a. d. L. über Parndorf nach Raab in Angriff genommen (Klosse Karl Josef, Bruck a. d. L., Wien [1855], 13). Die im Revolutionsjahr 1848 den Wienern zu Hilfe eilenden Ungarn sammelten sich nach ihrer Niederlage vor Wien auf der Heide bei Parndorf, wurden hier am 16. Dezember d. J. vom kaiserlichen Feldherrn Jellasinc gestellt und nach einstündigem Gefecht in die Flucht geschlagen (Christlbauer 30f.). Der Hausname "Kossuthovi" soll nach der Überlieferung damit in Zusammenhang stehen, dass damals Kossuth vor dem Haus, in dem gleichzeitig ein Knabe geboren wurde, an die Truppen eine Ansprache gehalten habe ( Vukovich 42). 1857 war auf der Parndorfer Heide ein großes Reitertreffen (14 Regimenter), bei dem auch das Kaiserpaar anwesend war (Christlbauer 34).
Zu Ende des ersten Weltkrieges erlebte der Ort den geordneten Rückmarsch der zum Großteil aus motorisierten Truppen bestehenden Armee des Feldmarschalls v. Mackensen, der vier Tage dauerte.
In der Zeit der Räteregierung weilte Béla Kun und Samuelly kurze Zeit im Ort. Zur eit des Anschlusses wechselten Freischärler und österreichische Volkswehr in der Besetzung des Ortes ab (Vukovich 44).
1939-1945 wurde der Ausbau des bereits 1915 angelegten Flughafens investiert. Zu Ostern 1945 war das Gebiet um Parndorf Kampfgebiet. Drei Tage stand die Front beim Siebenjoch und einen Tag beim Geißberg. 180 Gebäude wurden zerstört und 30 Zivilpersonen getötet (Vukovich 46f.).
Kirche und Pfarre
Parndorf ist vorreformatorische Pfarre, die 1430 eine "steinerne St. Benedikts-Kirche" besaß (Dl. 12266).Die heutige Kirche weist noch mittelalterliche Bauteile auf. Der Ort dürfte früher in der 1074 genannten Ortschaft "Nowendorf" (Neudorf bei Parndorf) eingepfarrt gewesen sein. Nach dem Türkeneinfall 1529 wurde der Ort mit Kroaten neu bestiftet und die Pfarre neu begründet. Nach dem Aufbau der Kirche wurde sie dem hl. Ladislaus geweiht. 1579ist der Pfarrer Lukas Masnik bei der Diözesansynode von Steinamanger anwesend, 1584 wird Matthäus Pfeiffer in den Klosterratsakten als katholischer Pfarrer genannt. Die Vis, can. aus 1659 lobt die Bewohner als brave Kirchengeher, sie sind alle katholische Kroaten. Von einer Protestantisierung der Gemeinde ist nichts erwähnt. Die heutige Kirche stammt aus den Jahren 1716-1718 und wurde unter den Grafen Raimund, Thomas und Alois Harrach erbaut und am dritten Sonntag nach Pfingsten 1718 von Bischof Ladislaus v. Nádasdy konsekriert. Hauptaltar St. Ladislaus, Seitenaltäre hl. Antonius und hl. Katharina. Die Orgel stammt aus 1860 (14 Register). Der Turm, ein alter Wehrturm, musste auf Anordnung der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg bis auf Höhe des Kirchendaches abgetragen werden, da er angeblich eine Gefahr für die Flieger bedeutete (Flugplatz). Nach 1945 wurde er wieder ausgebaut. Bemerkenswert ist die Kapelle zum hl. Vitus (Freisingerzeit?) und die Pestkapelle zu den Heiligen Sebastian, Florian, Rochus und Rosalia, zu der an den Festtagen der genannten Heiligen Prozessionen mit Predigt und Amt veranstaltet wurden. An Wallfahrten war jene nach Mariazell üblich, seltener ging man nach Eisenstadt und Frauenkirchen.
Rechtsaltertümer
Landgericht: Herrschaft Ungarisch-Altenburg, später Herrschaft Bruck a. d. L.
Marktrecht: 16. U. 17. Juli 1810: Oppidum Pahrendorf (Bruck a. d. L., Gräfl. Harrachsches Herrschaftsarchiv).
Jahrmärkte: 10. April, 15. Juni, 21 August, 16 Dezember.
Geistige Kultur
Besonderheiten im kroatischen Dialekt: Hier heißt der Hund "pas", Mehrzahl "psi" (im Eisenstädter und Oberpullendorfer Bezirk "kucak"). Schimpft der Parndorfer einen Menschen, dann sagt er: "Ti kucak"; schimpft er einen Hund, so sagt er: "Tipsinja para!" Der Rauchfang heißt hier "turam" (Turm). Auch der Kirchturm heißt so. Nur muss man diesen immer in Verbindung mit Kirche bringen, "crikveni turam". Das Fleisch wird im "Turm" geselcht. Geselchtes Fleisch heißt "suho meso" - trockenes Fleisch, anderswo aber "ukadjeno meso". Jeder Baum heißt vrba - Weide. Im Frühjahr pflanzen die Parndorfer kleine "vrbice" - Weiden, auf denen später Kirschen, Weichseln, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Nüsse usw. wachsen werden. Die wirkliche Weide heißt "zelena vrba" - grüne Weide oder "masno drivo" - fettes Holz. Die Namen der Wald- und Obstbäume kennen nur die wenigen, die mit den einzelnen Arten zu tun gehabt haben.
Das "krat - put" heißt hier "ras", das erstemal "prvi ras"; das zweitemal "drugi ras". "Klas" (als Schulklasse) ist weiblichen Geschlechtes ("Ovo dite die u petu klas"), "klas" (als Ähre) ist männlichen Geschlechtes (Mehrzahl: "klasi - klasje"). "Kafe" (Kaffee) und "te" (Tee) sind hier sächlich (im Eisenstädter Bezirk männlich). Die Nennform des kroatischen Zeitwortes wird auch auf die Fremdwörter aus dem Deutschen übertragen, z.B. "erlaubati". Bei Zahlenangaben benützen sie häufig deutsche Zahlwörter aus der Mundart, z.B. "Schilling fufzig", "fiazen Schilling" (Dir. Vukovich).
Architektur, Plastik, Malerei
Pfarrkirche zum hl. Ladislaus: mittelalterlich: Ostturm, Pilaster, Sakristei (unterer Teil. Ende 17. Jh.s: alte Sakristei, Barockzeit (18. Jh.): Schiff (Klaar). Turmhelm achteckige gemauerte Pyramide (im zweiten Weltkrieg abgetragen). Marienstatue Anf. 18. Jh.s. Gruft von Johann Graf Harrach 1826. Grabsteine von Geistlichen einer 1530 bez. (Dehio-Ginhart, Bd. 1, Wien u. Niederdonau 367), Dreifaltigkeitssäule am Dorfanger: Abgetrepptes Postament, niederer Sockel mit ausladender profilierter Deckplatte, Rundsäulenkopf mit Abacus, auf Wolkenthron Dreifaltigkeit (Tiziantyp). Inschrift: "Errichtet / und / gestiftet / von / Stefan / und / Maria / Popovich / 1874 / Renoviert durch / Anna Mikula / 1891." Dreifaltigkeitssäule auf der Hauptstraße: Breites Postament, quadratischer Sockel mit ausladender Deckplatte, Rundsäule mit Volutenkapitell, Dreifaltigkeitsdarstellung (Tiziantyp). Ohne Inschrift. Errichtet 1826. Herz-Jesu-Denkmal an der Bundesstraße: Hohes Postament, quadratischer flacher Sockel mit ausladender profilierter Deckplatte, auf niederem Aufsatz Herz-Jesu-Statue. Modern. Inschrift: "Sladko serce Jesusevo / smiluj se nam / postavno od familie / Reiter / 1919." (Maxwald Georg, Neusiedl a. S.) Kreuz an der Kirchenwand: Kruzifixus auf modernem Sockel. In seichter Nische betende Maria. Inschrift: "Mate Katharina Paare / 1883." Maria Empfängnis, auf der Hauptstraße: Doppeltes Postament, abgetreppter Sockel mit ausladender Deckplatte, flache Rundsäule, Volutenkapitell, Unbefleckte mit Strahlenkranz auf halber Weltkugel mit Schlange und Mondsichel stehend. Inschrift: "" Maria / prez griha / prijeta moli za naski pod tvodzu obranibu / tecerno postavljen / do / familie / Kosztovich / 1907." Unbefleckte vor Gemeindegasthaus: Sockel, dorische Säule, Unbefleckte auf Weltkugel mit Schlange. Schöne Arbeit, polychromiert. 4 Steindocken und schmiedeeisernes Gitter. Inschrift auf Marmortafel: "Ov pilj postavljen / u letu / 1733 / Ponovljen 1937 / od Maria Manz." Schloß: Erbaut vom Grafen Harrach, Bruck a. d. L. Raststation Kalrs VI. und Maria Theresias auf ihren Fahrten nach Halbturn.
Volkskundliches
Redensart vom Parndorfer Kirtag (Klier, D. d. Vl. 46 [1944], 79). W.H. Riehls Wanderung über die Parndorfer Heide 1867 (Mein Heimatvolk 198 f.). Kurelac, ein Parndorfer volkskundlicher Sammler (Schreiner, VuH III, Nr. 3, 4). Tracht der Kroaten (Harandek BHbl, Jg. 10 [1948], H. 4, 143). Bei Hochzeiten wird der "Kolotanz" aufgeführt. Ortsname (Zimmermann, Was die bgld. Ortsnamen erzählen, VuH I, Nr. 8, 2). Sagen: Der Bauernstein (MPL 36), Der weiße und schwarze Hund (ebd. 66), Abenteuer in der Walpurgisnacht (ebd. 102).
Gedruckte und ungedruckte Quellen: HKA B/29 E. Bruck a. d. L., Gräfl. Harrachsche Herrschaftsarchiv. Jandrisevits. Pfarrgedenkbuch. Literatur: Vukovich Maria, Geschichte von Parndorf, ungedruckte Hausarbeit 1951 (Bgld. Landesarchiv).